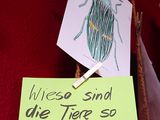Von Christina Kamp, freie Autorin
Naturkundemuseen, Zoos und botanische Gärten tun genau das, was auch der Ökotourismus vielerorts erreichen will: Bewusstseinsbildung und Wissensvermittlung zur biologischen Vielfalt. Sie können dabei sehr breitenwirksam sein, haben neben ihrem Bildungsauftrag einen hohen Freizeitwert und vermeiden einen großen Teil des ökologischen Fußabdrucks, den Reisen trotz guter Absichten mit sich bringen. Ebenso wie ökotouristische Angebote generieren sie Mittel für den Naturschutz.
Natürlich hat der Schutz von Flora und Fauna in ihren natürlichen Ökosystemen („in situ“) oberste Priorität. Denn biologisch umfasst Vielfalt nicht nur die Vielfalt an Arten auf diesem Planeten und die genetische Vielfalt innerhalb einzelner Arten, sondern auch die Vielfalt ihrer oft einzigartigen Lebensräume. Das Artensterben ist jedoch so dramatisch, dass viele bedrohte Arten nur in menschlicher Obhut („ex situ“) vor dem Aussterben bewahrt werden können. So zum Beispiel die Takhis (Przewalskipferde), die in freier Wildbahn als ausgestorben galten. Dank eines internationalen Zuchtprogramms konnten kleine Populationen in der Mongolei ausgewildert werden. Heute sind sie dort eine Touristenattraktion.
Für viele andere Arten, die nicht so prominent sind wie Takhis oder Pandas – Sympathieträger für den Artenschutz schlechthin – könnte solche Hilfe zu spät kommen. Der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) schätzt, dass eine Million Arten in naher Zukunft vom Aussterben bedroht sein könnten. Klimaveränderungen beschleunigen das Artensterben, aber auch die Abholzung von Wäldern, die Trockenlegung von Feuchtgebieten und die Verschmutzung von Gewässern. Auch der Tourismus ist an der Zerstörung natürlicher Lebensräume beteiligt.
Tourismus als Stressfaktor
Wie sehr Tourismus besonders für marine Lebensräume ein Stressfaktor ist, wird im Aquazoo Löbbecke Museum in Düsseldorf beschrieben: „Neben der Abwässer- und Müllentsorgung, dem erhöhten Energiebedarf, Verknappung von Trinkwasserressourcen, Luft- und Lärmbelastung werden Strände und Küsten durch Hotels, Parkplätze, Häfen, Straßen und Küstenschutz verbaut. Eiablage- und Ruheplätze, Kinderstuben und Fortpflanzungsareale von Meeresschildkröten und -vögeln sowie marinen Säugern werden stark eingeschränkt, dauerhaft geschädigt oder zerstört“.
Umso wichtiger ist ein umsichtiges Verhalten im Urlaubsland. Darauf weisen die im Europäischen Zoo-Dachverband (EAZA) zusammengeschlossenen Zoos im Rahmen ihrer Artenschutzkampagne „Vietnamazing“ hin. Sie laden ein, die einzigartige Biodiversität Vietnams gemeinsam zu schützen – durch Spenden, Öffentlichkeitsarbeit oder verantwortungsbewusstes Reisen, wenn man Vietnam besucht. Letzteres beinhalte, wildlebende Tiere nicht zu stören und keine illegalen Tierprodukte zu kaufen. Es wird gewarnt, dass viele Tiere, die als exotische Haustiere verkauft werden, gewildert wurden. Der illegale Handel mit Tieren oder Tierprodukten treibe die Ausrottung bedrohter Arten voran. Reisende, die Interesse an einem Haustier hätten, sollten sicherstellen, dass dessen Besitz legal ist und dass es verlässliche Informationen über dessen Herkunft gibt.
Krankheiten und invasive Arten
Das gilt auch für Pflanzen, die im Ausland als Zierpflanzen erworben werden. Die Wilhelma in Stuttgart zeigt, dass der Tourismus auch für seltene Pflanzen wie einige der südamerikanischen Bromelien eine Gefahr darstellt. Tourist*innen wüssten oft gar nicht, dass die Einfuhr vieler Pflanzen verboten ist. Selbst Pflanzen, die nicht unter Schutz stehen, müssten vom Zoll einbehalten und vernichtet werden, um zu verhindern, dass Schädlinge und Pflanzenkrankheiten mit eingeschleppt werden.
Am Beispiel europäischer Krebse zeigt der Aquazoo Düsseldorf, was passieren kann, wenn fremde Arten eingeschleppt werden: In unsere Gewässer eingeführte amerikanische Krebse übertragen die Krebspest. Die eingeschleppten Krebse sind dagegen immun, doch europäische Krebse sterben daran in Massen. Tourist*innen tragen leicht zur Verbreitung von Krankheiten und invasiven Arten bei, wenn sie Mikroorganismen, Samen, Insekten oder deren Eier an Kleidung, unter Schuhsohlen, im Gepäck oder in Fahrzeugen einschleppen oder wenn sie Pflanzen oder Tiere importieren. Invasive Arten bedrohen die biologische Vielfalt, denn sie konkurrieren mit heimischen Arten, sind oft anpassungsfähiger oder haben keine natürlichen Feinde im neuen Lebensraum. Dass insbesondere Amphibien in diesem Sinne zu den „Globalisierungsverlierern“ gehören, zeigt der Erlebniszoo Hannover.
Global denken, lokales Engagement fördern
Der Erlebniszoo stellt biologische Vielfalt auch in wirtschaftliche Zusammenhänge, ganz im Sinne des UN-Übereinkommens über die biologische Vielfalt (UN-CBD), das auch auf die nachhaltige Nutzung biologischer Vielfalt und die gerechte Aufteilung der daraus resultierenden Vorteile abzielt. Am Beispiel einer Schneckenfarm in Nigeria zeigt der Erlebniszoo, wie in einer durch Armut geprägten Region die Einkommen schaffende Zucht und der Verkauf von Riesenschnecken Wilderer überzeugen konnte, die illegale Jagd auf bedrohte Tierarten aufzugeben. Mit der Einbindung entwicklungspolitischer Inhalte ist der Erlebniszoo ein gelungenes Modell für einen außerschulischen Lernort für nachhaltige Entwicklung. Viele andere Zoos haben ihr Potenzial in diesem Bereich bei weitem noch nicht ausgeschöpft.
Wie auch Museen in dieser Hinsicht aktiv sein können, zeigt das kleine, aber feine Phyllodrom Regenwaldmuseum in Leipzig. Es wurde vor 25 Jahren gegründet, um – so beschreibt es seine Vorsitzende Bettina Grallert – auch denen eine Chance zu geben, biologische Vielfalt zu erleben, die nicht die Möglichkeit haben, dafür um die halbe Welt zu reisen. Mit vielfältigen Veranstaltungen und in Kooperation mit der Akademie für Umweltbildung in Aceh, Indonesien, fördert das Museum das Verständnis und für Regenwaldökologie und begeistert besonders Kinder und Jugendliche für ihren Schutz.
Komplexe Zusammenhänge
Ebenso in Zusammenarbeit mit Partner*innen im Globalen Süden entstand im Übersee-Museums in Bremen die Ausstellung „Der blaue Kontinent“. Sie zeigt, wie die Lebensgrundlagen der Menschen im Pazifik untrennbar mit dem Meer verbunden sind. Die Ausstellung macht komplexe Zusammenhänge deutlich, wie am Beispiel der Haie, die in Korallenriffen die Population kleinerer Raubfische kontrollieren, die wiederum Jagd auf pflanzenfressende Fische machen. Ohne Haie nimmt die Zahl der Raubfische zu und die Zahl der Pflanzenfresser ab. In der Folge können sich Algen vermehren und die Korallen schädigen. In jedem fünften Korallenriff seien Haie bereits ausgerottet, mit dramatischen Folgen, auch für den Tourismussektor. Nach einer Schätzung in der Ausstellung hat ein Riffhai im Laufe seines Lebens einen touristischen Wert von bis zu zwei Millionen US-Dollar.